Das Working Capital ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Situation eines Unternehmens. Es zeigt, wie effizient kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingesetzt werden, um den laufenden Betrieb zu sichern und Investitionsspielräume zu schaffen.
Working Capital ⇒ einfach erklärt
Zum Inhalt dieses Artikels
- Working Capital – Auf einen Blick
- Definition: Working Capital
- Berechnung von Working Capital: Formeln und Beispiele
- Interpretation eines positiven, negativen oder zu hohen Working Capitals
- Strategische Vorteile des Working Capitals für Unternehmen
- Working Capital Management: Maßnahmen zur Optimierung
- Fragen und Antworten
- Quellen
Wir schreiben unsere Inhalte ohne Chat-GPT & Co! Hier finden Sie nur redaktionell erstellte & geprüfte Infos für Deutschland 🇩🇪!
Mit FreeFinance und PaperCut: Automatische Belegerfassung direkt per Smartphone!
Jetzt testen!Working Capital – Auf einen Blick
|
Was ist das Working Capital? |
Das Working Capital zeigt, welche Mittel ein Unternehmen kurzfristig für Investitionen oder als Liquiditätspuffer einsetzen kann. Es gilt als zentrale Kennzahl für die finanzielle Stabilität und die Fähigkeit, laufende Verpflichtungen zu erfüllen. |
|
Wie wird das Working Capital berechnet? |
Es ergibt sich aus der Differenz zwischen Umlaufvermögen und kurzfristigen Verbindlichkeiten und berechnet sich mit folgender Formel: Working Capital = Umlaufvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten. |
|
Was bedeutet ein positives Working Capital? |
Ein positives Working Capital zeigt, dass ein Unternehmen Rechnungen eigenständig begleichen und kurzfristige Kosten abfedern kann. |
|
Was bedeutet ein negatives Working Capital? |
Ein negatives Working Capital deutet darauf hin, dass das Umlaufvermögen nicht ausreicht, um kurzfristige Verbindlichkeiten zu decken, sodass externe Finanzmittel erforderlich werden. |
|
Welche strategische Bedeutung hat das Working Capital für Unternehmen? |
Das Working Capital dient als Frühwarnsystem für Liquiditätsrisiken und unterstützt Planung, Budgetierung und Forecasting. Ein effizientes Working Capital stärkt Geschäftsbeziehungen, steigert die Kapitalrendite und signalisiert Investoren finanzielle Stabilität. |
|
Wie lässt sich das Working Capital optimieren? |
Das Working Capital lässt sich durch das Management von Lagerbeständen, Forderungen und Verbindlichkeiten optimieren, um Kapital freizusetzen und den Cashflow zu stabilisieren. Zusätzliche Maßnahmen wie Einkaufsfinanzierung oder Outsourcing von Nicht-Kernfunktionen verschaffen dem Unternehmen weiteren finanziellen Spielraum. |
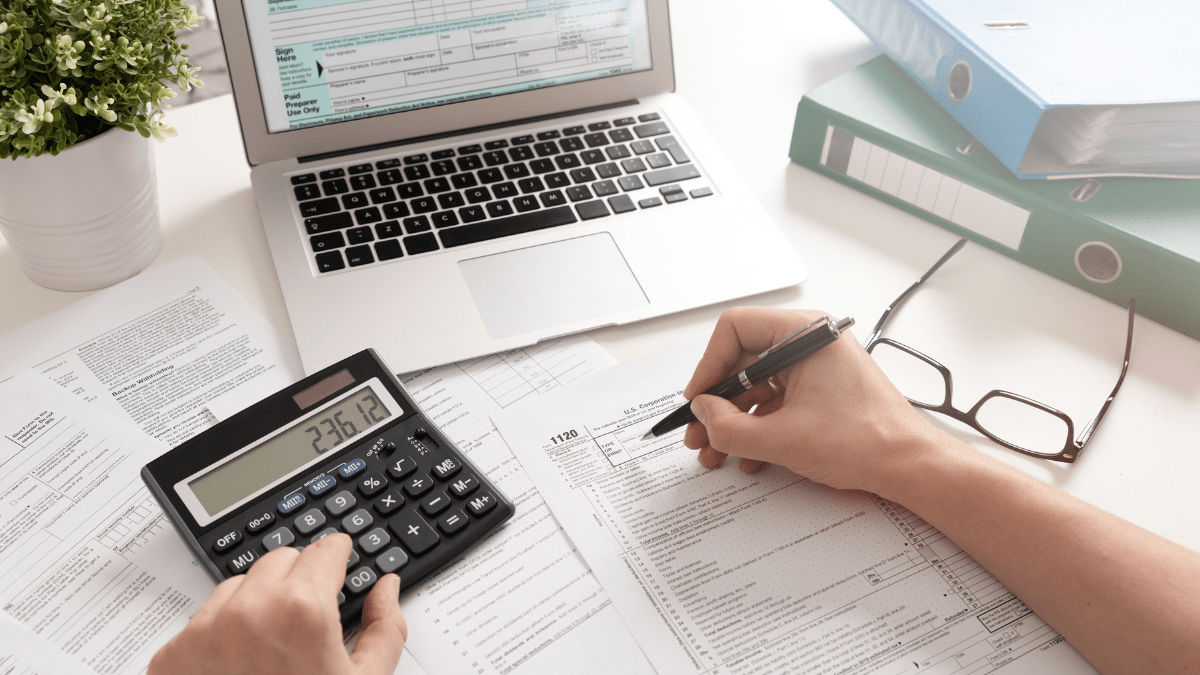
Das Working Capital bezeichnet den finanziellen Spielraum eines Unternehmens zur Deckung seiner kurzfristigen Verbindlichkeiten mit dem vorhandenen Umlaufvermögen. Es zeigt an, wie liquide ein Unternehmen ist und in welchem Maß es in der Lage ist, seinen laufenden Geschäftsbetrieb aus eigener Kraft zu finanzieren.
Definition: Working Capital
Das Working Capital, auch bekannt als Netto-Umlaufvermögen oder Betriebskapital, ist eine Kennzahl, die zeigt, wie solide ein Unternehmen finanziell aufgestellt ist und wie effizient es Rentabilität und Liquidität steuert.
Sie gibt Aufschluss darüber, wie viel Handlungsspielraum für Investitionen oder zur Absicherung gegen wirtschaftliche Schwankungen besteht. Damit gilt das Working Capital als zentraler Indikator für die Zahlungsfähigkeit gegenüber Geschäftspartnern und Investoren.
Berechnung von Working Capital: Formeln und Beispiele
Die Berechnung des Working Capitals ermöglicht es Unternehmen, die Zahlungsfähigkeit, Rentabilität und Effizienz im Umgang mit Kapital besser einzuschätzen. Je nach konkreter Kennzahl gibt es dazu drei verschiedene Formeln:
|
Kennzahl |
Formel |
Aussage / Bedeutung |
|---|---|---|
|
Working Capital |
Umlaufvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten |
Zeigt, wie viel Kapital nach Begleichung der kurzfristigen Schulden verbleibt |
|
Working Capital Ratio |
Umlaufvermögen ÷ kurzfristige Verbindlichkeiten × 100 % |
Misst die Liquidität im Verhältnis zur Schuldenlast – Werte über 100 % gelten als solide |
|
Net Working Capital |
Umlaufvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten – liquide Mittel |
Zeigt, welcher Teil des Umlaufvermögens tatsächlich zur kurzfristigen Finanzierung verfügbar ist |
Nachstehend noch einmal die Detailausführungen zu den drei Kennzahlen Working Capital, Working Capital Ratio und Net Working Capital:
Working Capital
Das Working Capital berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Umlaufvermögen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten eines Unternehmens.
-
Zum Umlaufvermögen zählen gemäß § 266 Abs. 2 B HGB alle Werte, die sich innerhalb eines Jahres in Geld umwandeln lassen, etwa Bankguthaben, Wertpapiere, Forderungen oder Lagerbestände. Sie dienen dem laufenden Geschäftsbetrieb und werden regelmäßig verbraucht, verkauft oder verarbeitet.
-
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten umfassen laut § 266 Abs. 3 C HGB dagegen alle Schulden und Zahlungsverpflichtungen, die innerhalb eines Jahres fällig sind, zum Beispiel Lieferantenrechnungen oder kurzfristige Kredite.
Formel: Working Capital = Umlaufvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten.
Beispiel: Ein mittelständisches Produktionsunternehmen verfügt über ein Umlaufvermögen von 500.000 Euro, das sich aus Bargeld, Forderungen und Warenbeständen zusammensetzt. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten, zu denen Lieferantenrechnungen und kurzfristige Kredite gehören, betragen 350.000 Euro. Die Berechnung lautet: Working Capital = 500.000 € – 350.000 € = 150.000 €.
Working Capital Ratio
Die Working Capital Ratio zeigt in Prozent, wie das Umlaufvermögen eines Unternehmens im Verhältnis zu seinen kurzfristigen Verbindlichkeiten steht. Ein Wert über 100 % signalisiert, dass das Unternehmen mehr Umlaufvermögen als kurzfristige Schulden besitzt, was auf eine solide finanzielle Lage hinweist.
Formel: Working Capital Ratio = Umlaufvermögen ÷ kurzfristige Verbindlichkeiten × 100 %
Beispiel: Ein Einzelhändler verfügt über ein Umlaufvermögen von 250.000 Euro, bestehend aus Bargeld, Forderungen und Warenbeständen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen 125.000 Euro. Die Berechnung lautet: Working Capital Ratio = 250.000 € ÷ 125.000 € × 100 % = 200 %. Das Ergebnis zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine kurzfristigen Verpflichtungen problemlos zu decken.
Net Working Capital
Das Net Working Capital, auch Netto-Umlaufvermögen genannt, zeigt den Teil des Vermögens eines Unternehmens, der zur kurzfristigen Umsatzgenerierung zur Verfügung steht und nicht durch Fremdkapital gedeckt ist. Es gibt an, welche Mittel das Unternehmen kurzfristig flexibel einsetzen kann.
Formel: Net Working Capital = Umlaufvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten – liquide Mittel
Beispiel: Ein Handelsunternehmen hat ein Umlaufvermögen von 400.000 €, kurzfristige Verbindlichkeiten von 250.000 € und liquide Mittel von 50.000 €. Das Net Working Capital beträgt:
400.000 € – 250.000 € – 50.000 € = 100.000 €. Diese 100.000 € stehen kurzfristig für den laufenden Geschäftsbetrieb zur Verfügung, etwa für den Einkauf neuer Waren.
Interpretation eines positiven, negativen oder zu hohen Working Capitals
Je nach Höhe des Working Capitals (positiv, negativ oder zu hoch) lassen sich unterschiedliche Rückschlüsse auf die finanzielle Situation eines Unternehmens ziehen.
Positives Working Capital
Ein positives Working Capital zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, Rechnungen aus eigener Kraft zu begleichen, kurzfristige Kosten abzufedern und Investitionen aus eigenen Ressourcen oder über Kredite zu finanzieren. Es besitzt genug finanzielle Möglichkeiten, um den laufenden Geschäftsbetrieb wie Gehälter oder Mieten zu sichern.
Beispiel: Ein Produktionsbetrieb mit 300.000 € nutzt den Überschuss, um neue Maschinen anzuschaffen und gleichzeitig einen Liquiditätspuffer für Auftragsschwankungen aufzubauen.
Negatives Working Capital
Im Falle eines negativen Working Capitals reicht das Umlaufvermögen nicht aus, um kurzfristige Verbindlichkeiten zu decken. Das Unternehmen ist auf externe Finanzmittel angewiesen, etwa Kredite oder Gesellschaftereinlagen.
Beispiel: Eine IT-Agentur weist ein negatives Working Capital auf, da viele Kunden erst spät zahlen, während Mieten und Gehälter sofort fällig sind. Das Unternehmen muss kurzfristig eine Zwischenfinanzierung aufnehmen, um liquide zu bleiben.
Zu hohes Working Capital
Ein zu hohes Working Capital deutet darauf hin, dass zwar keine Liquiditätsgefahr besteht, aber Kapital ineffizient gebunden ist – beispielsweise in zu großen Lagerbeständen, offenen Forderungen oder ungenutzten Bankguthaben. Das schmälert die Rentabilität, weil die vorhandenen Mittel nicht produktiv eingesetzt werden.
Beispiel: Ein Großhändler hält übermäßig hohe Lagerbestände, um jederzeit liefern zu können. Dadurch liegt Kapital brach, das besser in Marketing oder Produktentwicklung investiert wäre.
Strategische Vorteile des Working Capitals für Unternehmen
Die operative Steuerung des Working Capitals beeinflusst nicht nur kurzfristig die Liquidität, sondern hat für Unternehmen auch eine strategische Bedeutung:
-
Frühwarnsystem für Risiken: Ein sinkendes oder negatives Working Capital signalisiert frühzeitig mögliche Liquiditätsengpässe.
-
Grundlage für Planung und Absicherung: Das Working Capital liefert Daten für Budgetierung, Forecasting und die kurzfristige Liquiditätssteuerung.
-
Flexibilität und Resilienz: Unternehmen können neue Projekte starten, auf Nachfrageschwankungen reagieren und Lieferkettenprobleme abfedern.
-
Hebel für Profitabilität und Investitionen: Effizientes Working Capital reduziert gebundenes Kapital, steigert die Kapitalrendite und schafft Mittel für Wachstumsmaßnahmen.
-
Stärkung von Kunden- und Lieferantenbeziehungen: Gutes Liquiditätsmanagement ermöglicht flexible Zahlungsziele, Rabatte und stabilere Geschäftsbeziehungen.
-
Vorteil bei Finanzierungsrunden: Positives Working Capital zeigt Investoren wirtschaftlichen Erfolg und verbessert Verhandlungschancen.
Working Capital Management: Maßnahmen zur Optimierung
Das Working Capital Management steuert das Working Capital als Bilanzkennzahl und optimiert dessen Einsatz. Das Ziel ist, jederzeit ausreichende Liquidität verfügbar zu halten. Nachstehend die geläufigsten Maßnahmen im Rahmen des Working Capital Managements.
1. Bestandsmanagement
Ein gut abgestimmtes Bestandsmanagement trägt dazu bei, Kapital freizusetzen und Kosten zu senken. Eine zentralisierte Lagerverwaltung kann dabei helfen, Bestände an die tatsächliche Nachfrage anzupassen. Entscheidend ist, nur die benötigten Waren vorrätig zu halten: Zu große Lager binden Kapital, während zu geringe Bestände Lieferengpässe verursachen können.
Beispiel: Ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb erhöht in der Hochsaison seine Lagerbestände, um viele Aufträge bedienen zu können. In der Nebensaison werden die Vorräte gezielt abgebaut, wodurch weniger Kapital gebunden und das Working Capital entlastet wird.
2. Forderungsmanagement
Ein effizientes Forderungsmanagement sorgt für schnelle Zahlungseingänge und stärkt den Cashflow. Nach § 271a BGB dürfen Zahlungsziele in Handelsgeschäften 60 Tage nicht überschreiten. Verzögerte Zahlungen schmälern den finanziellen Spielraum, während klare Kreditrichtlinien, Frühzahlungsanreize und automatisierte Rechnungsverfolgung die Liquidität sichern. Bei Zahlungsverzug können Unternehmen gemäß § 288 BGB Verzugszinsen und Mahnpauschalen verlangen.
Beispiel: Ein Softwareunternehmen bietet Kunden kleine Skonti bei schneller Zahlung, wodurch Liquidität früher verfügbar ist.
3. Kreditorenmanagement
Die Kreditorenbuchhaltung erfasst alle Verbindlichkeiten eines Unternehmens gegenüber Lieferanten, Finanzinstituten oder öffentlichen Stellen für erhaltene, aber noch nicht bezahlte Leistungen. Gut gesteuerte Zahlungsverpflichtungen können das Working Capital entlasten, indem sie die Liquidität schonen. Entscheidend ist, Zahlungsbedingungen so zu gestalten, dass sie mit den Cashflow-Zyklen des Unternehmens übereinstimmen, statt Zahlungen unnötig hinauszuzögern.
Beispiel: Ein Handelsunternehmen steuert seinen Liquiditätsbedarf optimal, indem es die vereinbarten Zahlungsfristen seiner Lieferanten vollständig ausschöpft. Es verhandelt regelmäßig über Skonti und bessere Konditionen, um sein Working Capital gezielt zu verbessern.
4. Einkaufsfinanzierung
Die Einkaufsfinanzierung bezeichnet eine Finanzierungsform, bei der ein Zwischenhändler die Zahlung an den Lieferanten übernimmt. Das Unternehmen erhält die Waren oder Rohstoffe wie gewohnt, muss die Rechnung jedoch erst später an den Zwischenhändler begleichen. Dadurch verlängert sich das Zahlungsziel und die Liquidität des Unternehmens wird geschont, sodass mehr Kapital für andere Investitionen verfügbar bleibt.
Beispiel: Ein Produktionsunternehmen bestellt Maschinenkomponenten bei einem Lieferanten, die Zahlung übernimmt ein Finanzdienstleister. Durch das verlängerte Zahlungsziel kann das Unternehmen gleichzeitig in neue Produktionsanlagen investieren, ohne die laufenden Ausgaben zu belasten.
5. Schuldenkonsolidierung und -umstrukturierung
Unternehmen können ihr Working Capital entlasten, indem sie mehrere Kredite zu einem einzigen Darlehen mit günstigeren Konditionen zusammenfassen. Auch die Umwandlung kurzfristiger Schulden in langfristige Verbindlichkeiten kann die Liquidität verbessern und die Bilanz entlasten. Vorsicht ist jedoch geboten, da längere Laufzeiten manchmal höhere Gesamtkosten verursachen können.
Beispiel: Ein Bauunternehmen bündelt mehrere kurzfristige Kredite zu einem langfristigen Darlehen mit niedrigeren Zinsen. Dadurch reduziert es die monatlichen Belastungen und gewinnt finanziellen Spielraum, um laufende Projekte zu finanzieren, ohne neue Schulden aufzunehmen.
6. Outsourcing von Nicht-Kernfunktionen
Unternehmen können ihre Liquidität steigern, indem sie Aufgaben, die nicht zu den zentralen Geschäftstätigkeiten gehören, an externe Dienstleister auslagern. So reduzieren sie den Kapitalbedarf für Nebentätigkeiten und gewinnen finanzielle Mittel, die für Schuldenabbau oder die Verbesserung des Working Capital genutzt werden können.
Beispiel: Ein Einzelhandelsunternehmen lagert die IT-Wartung und das Facility-Management an externe Dienstleister aus. Dadurch sinken die laufenden Betriebskosten, und das freigesetzte Kapital kann in die Erweiterung des Filialnetzes investiert werden.
Fragen und Antworten
Was bedeutet der Begriff Working Capital?
Working Capital bezeichnet die Differenz zwischen dem Umlaufvermögen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten eines Unternehmens. Es zeigt, wie viel Kapital einem Unternehmen kurzfristig zur Verfügung steht, um laufende Ausgaben wie Gehälter, Mieten oder Lieferantenrechnungen zu begleichen.
Worin liegt der Unterschied zwischen Working Capital und Liquidität?
Die Begriffe „Working Capital“ und „Liquidität“ sind nicht identisch, auch wenn sie zusammenhängen. Das Working Capital zeigt, wie viel Kapital einem Unternehmen kurzfristig zur Verfügung steht und wie es finanzielle Verpflichtungen decken könnte. Es zeigt die potenzielle Liquidität, ist jedoch keine exakte Messgröße für tatsächlich verfügbare Mittel.
Welche Kennzahlen hängen mit dem Working Capital zusammen?
Relevante Kennzahlen sind neben dem Working Capital die Working Capital Ratio und das Net Working Capital. Sie geben Aufschluss über die kurzfristige Zahlungsfähigkeit und die Effizienz im Umgang mit Kapital. Unternehmen nutzen sie für Controlling und Finanzplanung.
Warum ist das Working Capital für Investoren relevant?
Ein positives Working Capital signalisiert finanzielle Stabilität und Flexibilität. Investoren erkennen, dass das Unternehmen kurzfristige Verpflichtungen decken kann. Gleichzeitig zeigt es Potenzial für Wachstum und strategische Investitionen.
Welche Möglichkeiten gibt es, Working Capital für Investitionen zu nutzen?
Unternehmen können überschüssiges Working Capital zielgerichtet einsetzen, etwa zur Finanzierung neuer Projekte, für Modernisierungen oder um Liquiditätspuffer aufzubauen. Dabei helfen optimierte Lagerbestände, verlängerte Zahlungsziele bei Lieferanten oder gezielte Finanzierungslösungen.
Quellen
-
Gesamte Rechtsvorschrift für Handelsgesetzbuch (HGB):
Gesetze im Internet – Bundesministerium der Justiz -
Gesamte Rechtsvorschrift für Bürgerliches Gesetzbuch (BGB):
Gesetze im Internet – Bundesministerium der Justiz